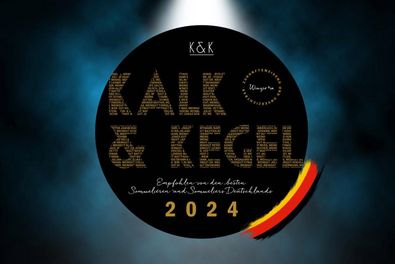Die wochenlange Schließung der Gastronomie hat dazu geführt, dass große Mengen an Fritten-Kartoffeln in den Lagern der Landwirte liegen bleiben. Etliche Erzeugerbetriebe säßen auf größeren Mengen Lagerware, die nun nicht mehr abfließen könnten, heißt es in einem Bericht des NRW-Umweltministeriums. Dass Restaurants mittlerweile wieder öffnen dürfen, ändert diese Situation nur bedingt: «Wir können nicht die Pommes, die wir in den letzten zwei Monaten nicht gegessen hätten, jetzt auch noch essen», sagte Bernhard Rüb von der Landwirtschaftskammer NRW der Deutschen Presse-Agentur. «Der eine oder andere könnte das vielleicht - aber es wäre sicher nicht gesund.»
Um industriell Pommes herzustellen, werden mehligkochende, möglichst große, längliche Kartoffeln benötigt. Die industrielle Herstellung erfolgt hauptsächlich in Fabriken in den Niederlanden. Angebaut werden die Fritte-Kartoffeln aber auch in Deutschland. «Es gibt zu wenig Holland für den Bedarf an Pommes», so Rüb. NRW ist neben Niedersachsen in Deutschland nach Angaben der Landwirtschaftskammer Hauptanbaugebiet für Fritten-Kartoffeln. Viele Landwirte haben feste Abnahmeverträge mit Fritten-Fabriken in den Niederlanden, darüber hinaus werden die Kartoffeln frei gehandelt.
Durch die Schließung der Gastronomie sei die Nachfrage nach Pommes in Deutschland, aber auch fast allen anderen europäischen Ländern «nahezu vollständig eingebrochen», berichtet das NRW-Umweltministerium. In den Lagern der Landwirte stapeln sich daher nun die Pommes-Kartoffeln, für die keine festen Verträge bestehen. Eine langfristigere Lagerung sei keine Option, erklärte Rüb: Denn durch den Verlust von Feuchtigkeit verlören die Kartoffeln an Gewicht und damit an Wert.
So seien die Bauern gezwungen, die Kartoffeln anders zu verwerten - etwa als Schweinefutter oder zur Verbrennung in Biogasanlagen. Damit gingen erhebliche Verluste einher, da die Landwirte ihre Kartoffeln für wenige Euro verscherbeln müssten.
(dpa)